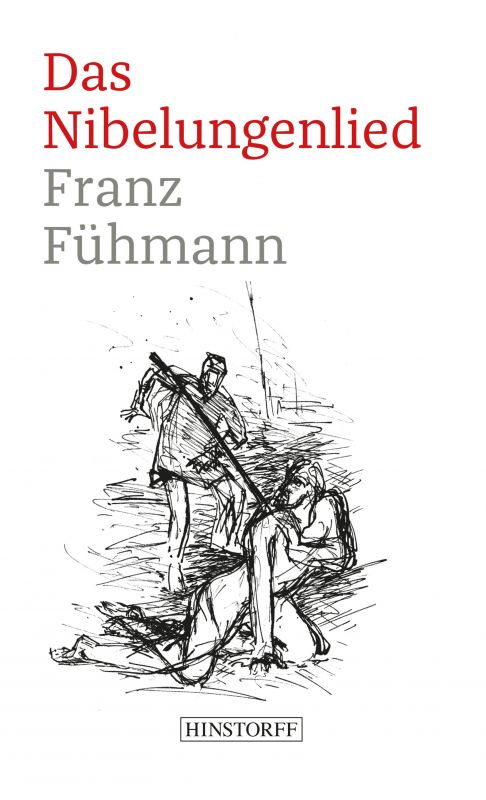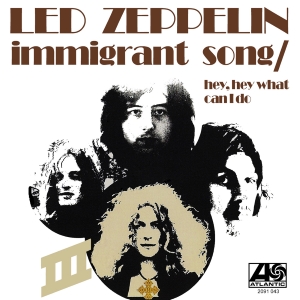Archäologie und Funde der Friesen: Fenster in die germanische Vergangenheit
In den Niederlanden und Deutschland an der Nordseeküste liegt das historische Siedlungsgebiet der Friesen, eines germanischen Volkes mit einer langen und bewegten Geschichte. Tief in den Marschen, auf Warften und in Mooren bergen sich Überreste einer faszinierenden Kultur. Archäologische Ausgrabungen fördern neben jungsteinzeitlichen Werkzeugen und Pflügen auch verborgenes Wissen über die Wirtschaftsweisen, sozialen Strukturen und Handelsbeziehungen dieser Seefahrer zutage. Während die antiken römischen Autoren ihre ersten Berichte lieferten, gewähren uns immer wieder spektakuläre Funde Einblicke in das Leben, die Kämpfe und den Alltag eines Volkes, das sich über die Jahrtausende an das raue Nordseeklima anpasste.
Die archäologische Spurensuche: Frühzeitliche Funde und zweite Blüte der Friesen
Die archäologische Forschung ergründet das Leben der Friesen von den frühesten Spuren menschlicher Besiedlung bis ins Mittelalter. Besonders in den Mooren Ostfrieslands, wie im Brockzeteler Moor oder Moor von Georgsfeld, wurden Artefakte aus der Mittelsteinzeit entdeckt. Von Bedeutung sind auch Pflugfunde, etwa der einer der ältesten bekannten Pflüge der Welt aus Georgsfeld, ursprünglich dem 4. Jahrtausend v. Chr. zugeschrieben, heute jedoch in die frühe Bronzezeit (1940–1510 v. Chr.) datiert. Solche Funde zeugen von einer langen agrarischen Tradition in einer Landschaft, die der Mensch mit einem ausgeklügelten Deich- und Bewässerungssystem bewohnte.

Aus der römischen Kaiserzeit berichten Plinius der Ältere und Tacitus von einem germanischen Stamm namens Frisii, den Vorläufern der späteren Friesen. Tacitus nennt sie in seiner „Germania“ als „Große“ und „Kleinere Friesen“, ansässig entlang des Rheins und in sumpfigen Küstengebieten. Die archäologische Fundlage und zeitgenössische linguistische Befunde lassen jedoch auf eine komplexe Entwicklung schließen: Zwischen den antiken Frisii und den friesischen Gruppen im Mittelalter besteht wahrscheinlich nur eine begrenzte Kontinuität. Um das 5. und 6. Jahrhundert scheint das Siedlungsgebiet weitgehend von anderen germanischen Völkern wie den Angelsachsen neu bevölkert worden zu sein. Eine Kontinuität des Stammesnamens deutet auf eine bewusste Identitätsannahme der späteren Friesen gegenüber dieser historischen Bezeichnung.
Im frühen Mittelalter, ab dem 7. Jahrhundert, stehen Friesen als ein seefahrendes, freies Volk in den Quellen. Sie errichteten neben Einzelwarften auch große Handelsdörfer (Wik), wie das zentrale Dorestad an der Flussgabelung von Rhein und Lek, das als blühende Handelsstätte Wollmäntel, Salz und Bernstein an Kunden bis ins Binnenland und nach Byzanz lieferte.
Gesellschaftliche Strukturen und Kultur der Friesen
Die soziale Ordnung der Friesen unterschied sich deutlich von feudalistischen Verhältnissen, wie sie in vielen Teilen Europas verbreitet waren. Archäologische Befunde, historische Quellen und Traditionsüberlieferungen zeugen von einem stark egalitären Aufbau. So wählten Landesgemeinden ihre Anführer selbst und pflegten autarke Rechtsordnungen, die in der sogenannten „Lex Frisionum“ aus der Zeit Karls des Großen schriftlich fixiert wurden.
Die Friesische Freiheit, symbolisiert durch den Upstalsboom, eine Steinpyramide aus Findlingen bei Aurich, und die regelmäßigen Versammlungen der Vertreter der sogenannten Sieben Seelande am Feste nach Pfingsten, unterstreichen die kollektive Entscheidungsfindung und die Verteidigung gemeinsamer Rechte gegen äußere Mächte.
Die Friesen waren bekannt für ihre Unabhängigkeit und ihren Widerstandsgeist, etwa gegen die römische Oberherrschaft oder später fränkische Versuche der Unterwerfung. Ihr Motto „Lieber tot als Sklave“ spiegelt die inneren Werte der Freiheit und Selbstbestimmung wider.
Architektur und Siedlung
- Warften und Wurten: Auf höheren Erdhügeln, von Menschenhand aufgebaut, errichteten die Friesen ihre Wohnstätten, um sich gegen Sturmfluten und Überschwemmungen zu schützen. Diese Siedlungsform existiert als steter Beweis menschlicher Anpassung an das Hochwasser der Nordseeküste.
- Langhäuser: Die Germanen bauten Langhäuser mit sehr ähnlichen Grundrissen über Generationen an denselben Orten. Gleichmäßige Maße und Anordnungen zeigen einen gesellschaftlichen Kodex, der auf Gleichheit und Vermeidung von Überbietung schloss.
- Handelsniederlassungen: Die Wik genannten Dörfer waren pulsierende Zentren von Handwerkern und Kaufleuten, bezeuge ihre enge Vernetzung mit dem mittelalterlichen Fernhandel.
Wirtschaft und Handel: Meeresanbindung und Handelsnetzwerke
Die Küstenlage und die Seefahrtradition ermöglichten den Friesen Handel weit über ihre Küstengebiete hinaus. Von der Fischerei und Salzgewinnung im Wattgebiet bis zum Fertigen und Export von Wollmänteln waren die Friesen in der ganzen Nordseeregion etabliert.
- Salzgewinnung: Salzhaltiger Torf wurde verbrannt, um so kostbares „friesisches Salz“ zu extrahieren, ein begehrtes Handelsgut von Römerzeit bis ins Mittelalter.
- Textilien: Die Verarbeitung von Ziegen- und Schafwolle zu Decken, Mänteln und feinen Stoffen fand großen Absatz, sogar bis nach Byzanz und in den arabischen Raum über Mittlerstationen. Fränkische Höfe erhielten regelmäßige Lieferungen.
- Handelsschiffe: Archäologische Funde wie das Friesenschiff von Roggenstede zeigen flach gebaute, stabile Boote, die dem Trockenfallen bei Flutstand Rechnung trugen. Die späteren hochbordigen Koggen der Hanse gehen auf diese Schiffsbauweise zurück.
- Handelsnetz: Von der Nordseeküste bis ins Binnenland, nach Dänemark, Schweden und sogar Byzanz handelten die Friesen Waren wie Bernstein, Pelze, Seide, Pfeffer und Gewürze.

Aufstände und Kriege: Die Friesen zwischen Römern, Franken und Sachsen
Römische Quellen berichten von Aufständen der Frisii, beispielsweise gegen die Ausbeutung durch den Statthalter Olennius, wie Tacitus erwähnt. Dies verdeutlicht, dass die Friesen früh Widerstandsgeist zeigten. Später kämpften sie gegen die fränkische Expansion unter Karl den Großen, der 785 das friesische Kerngebiet bis zur Weser eroberte. Trotz Unterwerfung blieb die friesische Selbstverwaltung und Freiheit außergewöhnlich stark ausgeprägt. Sie wurden aufgrund dessen erst im 11. Jahrhundert christianisiert.
Archäologische Analysen von Grabfunden wie in Bad Füssing zeigen gewaltsame Konflikte und Umbrüche in germanischen Regionen der Spätantike. Dort wurden beispielsweise ein offenbar im Kampf getöteter Reiter mit Schwerthieben geborgen, der in eine Zeit des Übergangs zwischen römischer und bajuwarischer Herrschaft datiert. Solche Funde liefern wertvolle Einsichten in die wechselvolle Geschichte germanischer Stämme, auch wenn sie nicht direkt auf die Friesen bezogen werden.
Funde und Fundorte von Bedeutung für die Friesische Geschichte
- Warften und Moorfunde – Überreste von Siedlungen, Gräbern und Alltagsgegenständen ermöglichen Einblicke in die Anpassungen an die Umwelt der Nordseeküste.
- Goldhort von Gessel (Niedersachsen, 2011) – Eine bedeutende Sammlung bronzezeitlicher (14. Jh.v.u.Z) Goldobjekte, die Einblicke in rituelle und soziale Verhältnisse vor Jahrtausenden bietet.
- Handelsplatz Dorestad (Niederlande) – Einer der wichtigsten friesischen Handelsorte, mit archäologischen Funden aus dem Hochmittelalter, die den Umfang des Fernhandels dokumentieren.
- Friesenschiff von Roggenstede (Ostfriesland) – Ausgrabung eines flach gebauten Segelbootes für die Nordsee, ursächlich für die spätere Entwicklung der Hansekogge.
Bild: Goldhort von Gessel

Herausforderungen der Quellenlage und Deutung des Friesischen Erbes
Die Quellenlage zur friesischen Geschichte ist teils fragmentarisch: Schriftliche Quellen aus römischer Zeit sind spärlich und meist von außen verfasst. Die Kontinuität zwischen antiken Frisii und den mittelalterlichen Friesen ist nicht unumstritten; archäologische und linguistische Studien legen nahe, dass es eher eine Namensübernahme mit Parteienwechsel gab als eine ethnische Durchgängigkeit. Die größte Zahl der schriftlichen Zeugnisse stammt aus dem Mittelalter, insbesondere durch Franken und Kirchenchronisten, während indigenous friesische Aufzeichnungen nur sehr begrenzt überliefert sind.
Archäologie, Linguistik und historische Forschung ergänzen sich gegenseitig, erlauben aber nicht immer eindeutige Schlüsse. Die Vielfalt der Funde – von bronzezeitlichen Goldhorten über römische Kampfspuren bis zu mittelalterlichen Handelsplätzen – legt ein komplexes Bild nahe. Dieses zeigt die Friesen als ein anpassungsfähiges, offen vernetztes Volk mit einer eigenständigen Kultur, die durch Umweltbedingungen und wechselnde politische Mächte geprägt wurde.
Fiktive Geschichte vom Kampf der Friesen gegen den Christen Karl Martell, der die Herrschaft der Franken 734 begründete
Ich heiße Hajo, Sohn des Wybren, und ich bin ein Friese vom Meer. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich noch immer Salz und Tang, höre das Schreien der Möwen über den Prielen und das Knarren der Boote im Wind. So begann mein Leben, lange bevor der Name Karl Martell wie ein Fluch über unsere Marschen kam.
Wir Friesen waren freie Männer. Das sagten wir zumindest. Frei wie das Wasser, das kommt und geht, frei wie der Wind, der unsere Segel füllt oder zerreißt. Wir lebten vom Handel, vom Fischfang, von dem, was wir dem Meer abtrotzen konnten. Unsere Götter kannten wir beim Namen, und sie kannten uns, glaubten wir. Wodan, Donar, die alten Mächte – sie wohnten im Sturm und im Feuer.
Als die Franken kamen, kamen sie nicht zuerst mit Schwertern, sondern mit Worten. Mit Priestern, die von einem einzigen Gott sprachen, und mit fränkischen Gesandten, die Tribute forderten. Manche unserer Häuptlinge beugten sich. Andere, wie unser Anführer Poppo, nicht. Ich war jung damals, stark in den Armen, schnell mit dem Sax in der Hand, und ich folgte ihm ohne Zögern.
Karl Martell war kein König, sagten sie, aber er herrschte wie einer. Ein Hammer, nannten ihn die Franken, und das passte. Wo er zuschlug, blieb nichts heil. Er wollte uns unterwerfen, unsere Küste sichern, unseren Glauben brechen. Für ihn waren wir ein Randvolk, ein Hindernis. Für uns war er der Mann, der uns die Freiheit nehmen wollte.
Die Schlacht, an die ich mich am deutlichsten erinnere, fand nahe der Boorne statt. Nebel lag über dem Land, feucht und kalt, als hätten die Götter selbst den Atem angehalten. Wir standen knöcheltief im Gras, Schilde an Schild, und warteten. Ich hörte mein eigenes Herz schlagen, lauter als das Klirren der Waffen. Neben mir murmelte jemand ein Gebet zu Donar.

Dann kamen sie. Die Franken in ihren geordneten Reihen, schwere Schilde, lange Speere. Keine wilden Krieger wie wir, sondern eine Wand aus Eisen und Disziplin. Und hinter ihnen, so schien es mir, der Wille eines einzigen Mannes.
Als es begann, gab es keinen Raum mehr für Angst. Nur noch Bewegung, Schreie, Blut. Mein Sax traf Fleisch, mein Schild fing einen Hieb ab, der mir sonst den Arm gespalten hätte. Ich sah Männer fallen, Friesen und Franken gleichermaßen. Der Boden wurde glitschig, und der Nebel färbte sich rot.
Irgendwann brach unsere Linie. Die Franken drängten nach, unerbittlich. Ich sah Poppo, wie er kämpfte, umringt von Feinden, bis er fiel. In diesem Moment wusste ich, dass wir verloren hatten. Nicht nur die Schlacht, sondern etwas Größeres.
Ich entkam, verletzt, gedemütigt. Viele taten das nicht. Nach dem Sieg kamen die Priester zurück, begleitet von fränkischen Kriegern. Taufen wurden erzwungen, Heiligtümer zerstört. Unsere Götter verschwanden nicht sofort, aber sie wurden leiser. Man erzählte sich, Karl Martell habe gesagt, ein unterworfenes Friesland sei besser als ein verbranntes. Großzügigkeit nannte man das.
Heute bin ich alt. Meine Hände zittern, wenn ich ein Messer halte, und das Meer klingt anders als früher. Meine Enkel tragen christliche Namen und machen das Kreuzzeichen, bevor sie essen. Manchmal fragen sie mich nach den alten Zeiten, nach den Schlachten, nach Karl Martell. Dann erzähle ich ihnen nicht von Hass, sondern von dem Gefühl, frei zu sein, auch wenn es nur für einen Moment war.
Karl Martell hat uns besiegt, ja. Aber er hat nicht alles genommen. Solange jemand sich erinnert, solange das Meer unsere Geschichten trägt, leben wir weiter. Ich bin ein Friese. Und das kann mir kein Hammer der Welt nehmen.
Quellen
- https://de.wikipedia.org/wiki/Friesen
- https://www.nordfriiskfutuur.eu/nordfrieslandlexikon/friesen/
- https://www.wikingar.de/Friesen-Geschichte-Kultur-und-Bedeutung-des-germanischen-Stammes
- https://www.museum-aurich.de/museum/der-upstalsboom-die-friesische-freiheit.html
- https://www.sueddeutsche.de/bayern/bad-fuessing-siedlungen-inn-bajuwaren-geschichte-archaeologie-li.3337079
- https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/graeberfeld-beleuchtet-anfaenge-der-bajuwaren/
- https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/nordhausen/article410517062/spuren-alter-welten-archaeologen-entdecken-im-kreis-nordhausen-die-geschichte.html
- https://www.compact-online.de/germanen-die-5-spektakulaersten-funde/